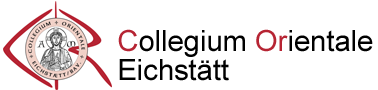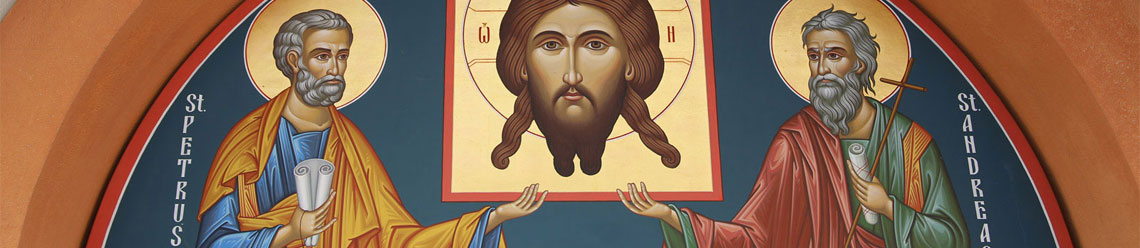Ausharren an der Grenze zum Lande des Terrors – ein Besuch bei den Christen im Irak
Der Vizerektor des Collegium Orientale Eichstätt, Archimandrit Dr. Thomas Kremer, hat im März 2016 zusammen mit Prof. Dr. Karl Pinggéra (Marburg) die christlichen Gemeinden im Irak, näherhin in der Autonomen Region Kurdistan, besucht. Einige seiner Eindrücke hält er in diesem Beitrag fest.
Ruhig ist es auf der Terrasse von Mor Mattai, kein Geräusch ist zu hören. Der Blick schweift in die Ferne, die Ebene liegt zu unseren Füßen. Es ist Frühling. Die Felder stehen in saftigem Grün, die Sonne scheint hell und klar. Kornkammer Mesopotamien, uraltes Kulturland. Alles wirkt so friedlich, so harmlos, so in Ordnung, wo doch von Ordnung und Friede die Rede nicht sein kann. Unser Blick schweift vorbei an Ninive hinüber nach Mossul, Hochburg des sogenannten „Islamischen Staates“, der gar nicht verdient „Staat“ genannt zu werden und „islamisch“ eigentlich auch nicht. Da unten stehen sie, die Schergen islamistischer Söldner aus allen Landen, kaum drei Kilometer entfernt. Da irgendwo verläuft auch die Front zwischen den Feldern. In der Ebene kleine Städte, ehemals christlich. Heute sind sie verlassen, überrannt nicht nur von wütenden Kriegern, sondern vor allem vom Hass und der Verstocktheit derer, für die Respekt und Achtung des anderen und seiner Kultur Fremdworte sind. Da stehen wir nun, in dem syrisch-orthodoxen Kloster, das, so erzählt die Geschichte, 363 gegründet, sich klammert an den Berghang des Jebel Maqlub, sich im Innern in Höhlen in ihn auch eingrub, um sich untrennbar mit diesem Land zu vereinen. Mehr als eineinhalb Jahrtausende ist hier der Lobpreis Christi erklungen, in seiner eigener aramäischen Sprache. Über allem schwebt heute gespenstische Ruhe: Ist es die Ruhe vor dem nächsten Ansturm des Wahnsinns? Die Totenruhe der geplünderten Städte, die hinaufsteigt? Die Angststarre derer, die geblieben sind und doch nicht wissen, wann vielleicht auch sie Hals über Kopf weglaufen müssen, eine der ältesten christlichen Stätten verlassend?!Der Besuch in Mor Mattai steht symptomatisch für das, was man erleben kann, wenn man heute zu den Christen im Irak aufbricht: ein Leben am Rande des Abgrunds, das aber voll ist von Hoffnung und einem Tatendrang, bei dem nicht immer klar ist, ob es wirklich Zuversicht oder auch Trotz ist, der zum Neuaufbau antreibt. Viele Christen haben das Land längst verlassen. Die andern konzentrieren sich auf einige Orte. Sicher, in Bagdad sind manche geblieben, es ist ja die Hauptstadt. Doch die meisten sind in Erbil, dem Zentrum der Autonomen Region Kurdistan. Oder um genauer zu sein: in Ainkawa, einem in sich geschlossenen Vorort nördlich der Stadt, selbst schon zur eigenen Stadt geworden. Hier wohnen nur Christen. Der Begriff des Ghettos wäre zu vorbelastet und auch zu negativ besetzt. Und doch lebt man unter sich, Christen verschiedener Bekenntnisse, die „Ökumene des Blutes“ schweißt sie zusammen. Den Einheimischen mangelt es nicht an Geld, die Häuser sind bestens in Schuss. Für die vielen freilich, die geflüchtet sind, Zehntausende aus Mossul und den eroberten christlichen Orten der Ebene, die meisten von ihnen syrisch-katholisch, ists freilich bitter, das Erbland der Väter in 30 oder 50 Kilometer Entfernung verwüstet zu wissen und selbst in Containern zu darben, demütig auszuharren in Blechbüchsen, die wie Karawanen von einem Kriegsschauplatz dieser Erde weiterziehen zum nächsten.
Immerhin professionell eingerichtet sind sie und gut auch versorgt, nicht nur mit dem Brot allein, das der Tod wahren menschlichen Lebens ist. An einem Abend werden wir eingeladen ins Flüchtlingscamp Mar Elia. Der Apostolische Nuntius, Bischof Alberto Ortega Martín, macht seinen Antrittsbesuch im Norden des Landes. Sehr praktisch, so ist alles bereitet und wir brauchen bloß seinen Fußstapfen zu folgen, um überall offene Türen zu finden. Im Camp Mar Elia empfängt uns Pfarrer Douglas al-Bazi. Er war in den Händen des IS, doch ist ihm entronnen: ein Mann voller Tatendrang. Unermüdlich müht er sich um die vielen inlandsvertriebenen Christen, baut Camps auf, reist ins Ausland, sammelt Geld, vermittelt Exil, besonders im Osten Europas. Unter dem Vielem, was mich an ihm faszinierte, ist eines besonders zu nennen: Er hat den ganzen Menschen im Blick, Leib und Seele vereint, darin offenbart sich sein wahrhaft christlicher Geist. Zum Konzept seiner Camps gehört zunächst und vor allem ein Kirchengebäude: Ort der Zuflucht, der Hoffnung, des Trostes – sicherer Anker in Zeiten des Sturms, so wie zugleich Bischöfe und Priester als geistliche Väter Zuflucht und Heimat der vertriebenen Seelen sind. Professionelle Behandlung der Traumatisierten und Betreuung der Kinder nach einem wohldurchdachten, anspruchsvollen pädagogischen Konzept in Kindergärten und Schulen sind sichergestellt: Hier werden Menschen nicht bloß irgendwie halbherzig versorgt, hier wird einer Generation vermittelt, dass es Zukunft gibt, für sie, und zwar in ihrem eigenen Land. Die selbst bereiteten Speisen schmeckten köstlich, und zu Ehren der Gäste wurden Tänze aufgeführt. Die Kinder hatten ihren Spaß und die Erwachsenen auch. Das Leben geht weiter, auch am Rande des Abgrunds, und es ist viel zu kurz und zu wertvoll, um sich die Freude daran stehlen zu lassen.
Einer, der wie kaum ein anderer vieles bewegt, war auch mit dabei: Erzbischof Bashar Warda, das Oberhaupt der katholischen Chaldäer in Erbil. Mit 46 ist er noch jung, über fünf Jahre schon leitet er das Geschick seiner Kirche vor Ort, ein Mann, der an die Zukunft der Christen glaubt. Er predigt mit Überzeugung vom Bleiben und begeistert viele, schenkt den Menschen stets neuen Mut. Er ist aber auch ganz ein Mann des Konkreten, ein begnadeter Organisator seiner Projekte: neue Kirchen ließ er entstehen, baute ein Zentrum mit Priesterseminar, kirchlicher Kurie und Wohneinheiten für vertriebene und alte Priester, und er steht überall zur Seite, wo es in den Camps an irgendetwas mangelt. Er ist ein Mann unserer Zeit, der es auch versteht, die kurdische Regierung für die Sache der Christen zu gewinnen, die schon Millionen in seine Projekte gesteckt hat. Das jüngste Vorhaben ist die Katholische Universität Erbil. Am 8. Dezember 2015 gegründet, ist der Campus gerade im Entstehen begriffen. Nun werden zahlreiche Hektar Ackerland am Rande der Stadt verwandelt in ein Zentrum der Bildung – professionell und mit hoch gesteckten Zielen.
Es ist erstaunlich, doch beschreiben diese Eindrücke die Grundstimmung Ainkawas. Trübsal und Resignation trifft man nur selten, obschon an Gründen dafür Mangel nicht herrschte. Man hat den Eindruck, ein jeder versucht, das Beste in seiner Lage zu tun, konzise und stets das Ziel vor Augen. Von dem orientalischen Phlegma, das den Dingen ihre Patina anhaften und die Menschen gleichgültig erscheinen lässt, ist kaum etwas zu spüren. Dafür aber gibt es viele Idealisten, deren Taten es wert sind, sich dem Gedächtnis der Menschheit einzuprägen. Einer von ihnen ist P. Nageeb Michaeel OP. Er ist ein echter Büchernarr, liebt seine Handschriften wie eigene Kinder und schläft gar bei ihnen. Er war es, der den Ernst der Lage witterte und aus Mossul rettete, was einer allein retten kann: die Bibliothek der Dominikaner mit ihren kostbaren Schätzen, mit Schubkarren und einer alten Camionnette im letzten Augenblick in Sicherheit gebracht. Großartige Bauten können die Christen des Orients nicht vorweisen, keine Dome und Kathedralen wie hierzulande. Ihr kulturelles Gedächtnis lebt in den Büchern, in den Manuskripten vergangener Jahrhunderte, welche die Poesie der großen syrischen Dichter auffangen, ein Florilegium poetisch-symbolischer Theologie, wie es nur von Menschen gepflückt werden kann, für die die Schönheit der Worte Ersatz ist für den Mangel an Farbe in der Kargheit der Wüste. „Centre Numérique des Manuscrits Orientaux Dominicains“ steht stolz an der primitiven Behausung von P. Nageeb im Erdgeschoss eines unvollendet gebliebenen Hotels. Dort arbeitet er unermüdlich mit seinem Team, katalogisiert, digitalisiert und restauriert auf höchstem Niveau. Absurde Nostalgie in Zeiten größerer Not? Keinesweg. Der Mensch braucht Identität, und P. Nageeb rettet, was christliches Leben im Irak immer schon ausmachte.
So gehen auch wir den Spuren der Geschichte nach und fahren nach Mor Mattai, nach Alqosh mit seinen Klöstern Rabban Hormizd und Notre Dame des Semences, begegnen dem Archidiakon Emanuel Youkhana von der Assyrischen Kirche des Ostens in Dohuk, dem Leiter des „Christian Aid Program Nohadra-Iraq“, und besuchen auch das Heiligtum der Jesiden in Lalesh. Mesopotamien: Land der Aramäer, Assyrer, Chaldäer. Die Völker von einst gibt es nicht mehr, doch die Christen von heute lassen die Erinnerung an sie weiterleben, wenn sie sich selbst nach ihnen benennen. Anachronistisch mag man das nennen. Und auch wenns so ist, dann ist wie in allem doch auch etwas Wahres daran: dass nämlich die irakischen Christen zutiefst ihrem Lande verbunden sind, gleichsam mit ihm verwachsen seit den ersten Tagen der Christen. Sie wollen nicht bloß Ausharren an der Grenze zum Lande des Terrors. Sie wollen leben und das Leben der anderen fördern, wollen lebendiger Teil einer modernen irakischen Gesellschaft sein, Teil ihres Landes, das in seiner langen Geschichte immer schon verschiedene Kulturen, Ethnien und Religionen miteinander zu vereinen vermochte. Die neue Katholische Universität in Erbil-Ainkawa ist vielleicht das sprechendste Zeichen der Hoffnung, dass es Zukunft gibt in diesem Land – auch für die Christen.
Wenige Tage und doch eine Fülle von Eindrücken. Nur ungern bestieg ich die Maschine nach Ankara, Istanbul und weiter nach München. Gerne wäre ich noch geblieben. Die Gastfreundschaft der Iraker ist großartig, ihre Herzlichkeit anrührend, Ainkawa, ja auch Alqosh und Dohuk sind Orte, in denen man bleiben möchte. Zuhause bei Freunden, Schicksalsgenossen, denn wem könnte das Schicksal anderer Christen je gleichgültig sein. Und dennoch: Es war Mor Mattai, das sich mir am tiefsten ins Herz gegraben hat. Shawki Sham‘un, ein junger syrisch-katholischer Christ aus Baghdeda, hat uns dorthin begleitet. Auf der Terrasse des Klosters hält er mit dem Feldstecher Ausschau. Vor ihm ein Hügel und dahinter ebenjenes Baghdeda, seine Heimat. So nah, ein Fußweg von zwei Stunden vielleicht, und doch unerreichbarer als eine verlassene Insel im Ozean. Auch er gehört zu denen, die am 6. August 2014 Hals über Kopf weglaufen mussten. Wann er je seine Heimat wiedersehen wird, ist ungewiss. Und was er dann wiederfinden wird, wenn der Weg über den Hügel noch einmal frei wird… Die Christen im Irak sind traumatisiert, und doch lebt die Hoffnung in ihnen weiter. Im Diwan des Klosters begegnet uns später die Familie des Shamshono Jakob Matti. Auch sie mussten fliehen, aus Bartilla in der Ebene, und wohnen heute in Zako. Ob sie noch einmal zurückkehren oder für immer den Irak verlassen werden? Ja, sie wollen zurück, wenn ihnen internationaler Schutz gewährt wird, zurück in ihre Heimat, denn wenn sie sich erst in alle Welt zerstreut haben, ist ihre Kultur und ihr Erbe für immer verloren. Und so bleibt, wer bleiben kann. Der Bischof und die sechs Mönche von Mor Mattai harren aus am Rande des Abgrunds und strahlen die beeindruckende Zuversicht aus, dass der IS die letzten beiden Kilometer zu ihnen nie überwinden werde. Und die kurdischen Peschmerga versichern uns, sie hätten die Lage völlig im Griff.
Wir verlassen den Diwan und treten in der Kirche mit Vater Jakob an das Grab des Gründers Mor Mattai und an das Grab des großen Gregorios Bar Hebräus. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns gleichermaßen vertraut sind, die Worte Jesu, in seiner eigenen Sprache: „Wa-shebuq lan chaubain wa-chtohain, aikano d-of chnan shbaqn l-chayobain…“ Welch eigenen Klang entfalten diese Worte aus dem Vaterunser an diesem Ort: „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern…“ Ein anrührender Augenblick, der erklärender Worte nicht bedarf. Christliche Präsenz im Nahen Osten ist mehr als die Sache persönlichen Glaubens. Christentum ist kulturprägend und kulturbildend. Es hat die Kraft, Frieden zu stiften in einem Landstrich, zu dessen Identität immer auch religiöse Pluralität gehörte. Es gibt viele gute Gründe dafür, darauf zu hoffen, dass Christen dort weiterhin Zukunft haben werden.
Thomas Kremer
(zuerst veröffentlicht auf: weitblick.bistum-eichstaett.de)