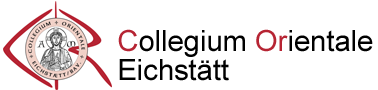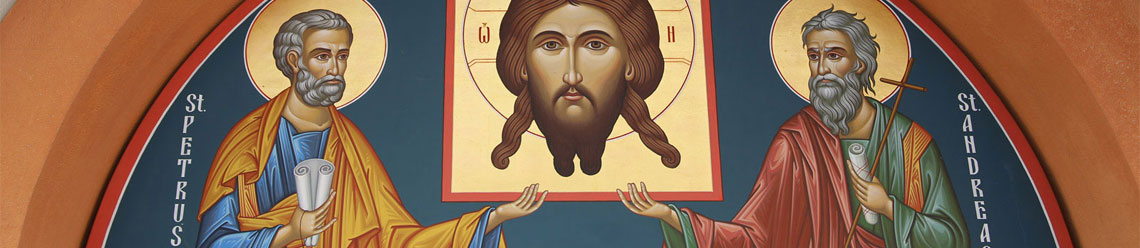Interview mit P. Nikodemus Claudius Schnabel OSB
"Die christlich-konfessionellen Streitereien sind wirklich nur peinlich!"
alias
"Es ist peinlich und erbärmlich, wenn wir uns streiten"
Interview mit P. Nikodemus Claudius Schnabel OSB, Dormitio-Abtei, Zion/Jerusalem
P. Nikodemus Claudius Schnabel OSB, Direktor des Jerusalemer Instituts der Görres-Gesellschaft (JIGG), Leiter der Bibliothek sowie Pressesprecher der Dormitio-Abtei und Katholischer Auslandsseelsorger für Deutschsprachige im Heiligen Land weilte letzte Woche in Deutschland. Zu den wichtigen Terminen gehörten die Abtsbenediktion von P. Winfried Schwab OSB in Heidelberg (Stift Neuburg) und Lesungen aus seinem neuesten Buch „Zuhause im Niemandsland – Mein Leben im Kloster zwischen Israel und Palästina“ (HERBiG-Verlag, München 20152, 175 S., ISBN: 978-3-7766-2744-2). Am 10./11. März 2016 besuchte P. Nikodemus das Collegium Orientale. Rektor Dr. Oleksandr Petrynko führte mit dem Gast dieses Interview.
P. Nikodemus, aufgrund Ihrer biographischen Angaben im Internet wird schnell klar, dass Sie zu den Mönchen und Wissenschaftlern gehören, die sich mit der Ostkirche beschäftigen. Woher kommen Ihre Sympathien und Ihr Interesse für die Ostkirchen? Möchten Sie uns von Ihren ersten Begegnungen mit der Ostkirche bzw. mit Personen der Ostkirchen erzählen?
P. Nikodemus: Ich komme aus einer Künstlerfamilie und bin ein Scheidungskind. Meine Mutter war Schauspielerin und mein Ziehvater, dem ich jetzt mein jüngstes Buch gewidmet habe, war ein Künstler aus Polen. Dadurch sind wir öfter umgezogen. Bei uns zu Hause waren sehr oft und viele Polen, Ukrainer, Russen, Bulgaren oder auch Österreicher. Auf diese Weise habe ich Ost- bzw. Südosteuropa in diesen Künstlern schon als Kind kennengelernt. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Die erste Begegnung mit der Ostkirche war in Bischofsheim an der Rhön. Es war damals eine russische Künstlergruppe da und sie wollten eine Göttliche Liturgie. Als kleines Kind bin ich da mitgegangen in diese ganz kleine, ja Minikirche mit einer Miniikonostase. Ich war damals noch sehr jung. Ich habe damals noch nicht verstanden, worum es geht. Was mich damals fasziniert hat, war die Liturgie selber, wie sie gefeiert wurde. Ich war begeistert, dass der Priester da aus der einen Tür herauskommt, in die andere hineingeht; er hatte einmal etwas auf dem Kopf und einmal nichts. Damals habe ich zum ersten Mal gesehen, worüber ich dann in meinem Gewänderbuch geschrieben habe [N. Schnabel, Die liturgischen Gewänder und Insignien des Diakons, Presbyters und Bischofs in den Kirchen des byzant. Ritus, Echter-Verlag, Würzburg 2008]. Mein erster Kontakt mit der Ostkirche war eben ein nonverbaler. Eigentlich so wie in der Nestorchronik, nach der die Gesandten des Großfürsten von Kiew meinten, beim Besuch des Gottesdienstes in der Hagia Sophia in Konstantinopel im Himmel gewesen zu sein. Das hat bei mir ein Wau-Erlebnis hervorgerufen. Für mich, eben als Schauspielerkind, war das ein heiliges Schauspiel. Ein Schauspiel kannte ich ja. Das war aber ein Schauspiel, das noch mehr beinhaltete. Ich bin bis heute ein Liturgiewissenschaftler. Das heißt, mein Weg zur Liturgie kommt tatsächlich von dieser Erfahrung. Ich bin zu Hause nicht im Glauben erzogen worden. Die Liturgie hatte in mir den Glauben geweckt und auch die Liebe zu den Ostkirchen. Das war sozusagen der Beginn zur byzantinischen Orthodoxie.
Das mit der Liebe zur orientalischen Orthodoxie, das war auch ganz interessant: Die kam dann später. Während meines Studiums habe ich bei McDonalds gearbeitet, also bei einer Fastfood-Kette. Dabei war ich der einzige Deutsche und ich dachte mit mir waren lauter Araber und Türken. Da dachte ich zuerst: alles Muslime. Wir hatten dann einmal Pause, am 14. August. In der Pause hat mich ein ägyptischer Araber angesprochen und gesagt: „Du willst Priester werden und isst heute einen Big-Mac?“ „Entschuldigung!“, sagte ich, „Wieso denn nicht?“ Er antwortete: „Es ist doch Marienfasten.“ „Was hast Du da mit Marienfasten?“, sagte ich. „Ja, fastet Ihr nicht vor dem Marienfest? Wir Kopten, wir tun es!“ Dann wurde mir klar, dass er kein Moslem ist. Es hat sich herausgestellt, dass keiner der Mitarbeiter ein Moslem war. Der Ägypter hat mich aufgeklärt, wer woher kommt. Der einer war Syrer, der anderer Assyrer… Es waren wirklich alles orientalische Christen. Das war mein erster Kontakt zur orientalischen Orthodoxie. Dann haben sie mich auch eingeladen: Ich war auf einer koptischen Verlobung und dann zur Hochzeit in Waldsolms/Kröffelbach. Der Zugang zu den orientalischen Kirchen erlebte ich durch ganz einfache Gläubige, von denen ich nur ein Arbeitskollege war und die mir auch von ihrer Frömmigkeit erzählt haben.
Mein Zugang zu den Ostkirchen scheint vielleicht ein wenig komisch, zunächst als Kind über die Liturgie und dann einfach mitten im Leben. Beides mal waren es Erfahrungen einer komplett neuen Welt. Das war ein doppeltes Aha-Erlebnis und ich dachte mir, dies möchte ich gerne auch weitergeben. Natürlich erwacht dann das Interesse während des Studiums.
Hat dieser Bezug zu den Ostkirchen später auch bei der Wahl Ihrer Mönchsheimat, des Klosters, nämlich der Benediktinerabtei in Jerusalem, eine Rolle gespielt?
P. Nikodemus: Ja! Es hat schon eine Rolle gespielt bei der Bewerbung zum Theologischen Studienjahr. Ich war damals Fuldauer Seminarist. Schon während des Studiums erwachte mein Interesse für die Ostkirchen und die Liturgiewissenschaft. So ging es in meiner ersten Seminararbeit um liturgische Geräte. Über liturgische Gewänder habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Das hat mich sehr interessiert. Im Priesterseminar gab es damals Mazedonier. Ich wohnte also Tür an Tür mit den Seminaristen aus den katholischen Ostkirchen. Und dann kam Jerusalem: Diese Stadt hat mich tatsächlich fasziniert. Unter den Bewerbern war ich wohl einer der wenigen, die den Schwerpunkt nicht auf "Land der Bibel", nicht "Judentum-Islam", sondern wirklich "Land der Ostkirchen", in dem wirklich die Kopten, die Syrer, die Äthiopier, die Armenier, die Griechen: alle da sind. Tatsächlich konnte ich in Jerusalem dies alles vertiefen. Ich habe in der Zeit wirklich auch bewusst, nach allen Kirchen und Liturgien gesucht und neue Freundschaften geschlossen. So wurde mein Interesse für die Ostkirchen immer stärker. Jerusalem hat mich dann so gepackt, dass ich dort geblieben bin.
Wir haben über die Gewänder sowie Insignien und auch über das heilige Schauspiel der Liturgie gesprochen, also eher über die äußeren Elemente der ostkirchlichen Liturgie. Was gefällt Ihnen – vielleicht an einem oder zwei Beispielen – inhaltlich an der Liturgie der Ostkirchen?
P. Nikodemus: Die Gestalt ist bei der Feier der Liturgie sehr wichtig und da ist die römisch-katholische Liturgie auch sehr schön, wenn die Westkirche es gut macht. Ich bin halt ein großer Freund der nonverbalen Verkündigung. Das Wort ist natürlich wichtig und man darf das Gesagte nicht missverstehen. Aber ich glaube, wir haben manchmal eine Überakzentuierung des Wortes. Natürlich ist für die Ostkirche das Wort auch wichtig. Wenn ich aber in einen Gottesdienst gehe, in dem die Predigt eine Stunde dauert, dann brauche ich erst Abitur, um überhaupt zu Gott finden zu können. Wenn ich mich erinnere, als ich als kleines Kind an dieser orthodoxen Liturgie teilnahm, da habe ich nichts verstanden, aber wirklich nichts und hatte noch keine Ahnung. Aber das Nonverbale, die Gewänder, die Gesänge, der Weihrauch, die Bewegungen haben bei mir einen Eindruck hinterlassen, wo ich gespürt habe: die Leute meinen es ernst, hier ist etwas wie ein Mysterium: Hier ist Gott mitten unter uns, er ist zugegen. Und dies ist für mich auch das Ernstnehmen der Inkarnation. Wir glauben nicht, dass Gott Buchstabe wurde, sondern Gott wurde Fleisch. Das heißt, in Jesus Christus war er sichtbar, riechbar, fühlbar, ansprechbar, hörbar. Wir hier im Westen sagen, besonders Luther formulierte es extrem: Der wichtigste christliche Sinn sei das Gehör. Hier muss ich sagen: Nein, so ticke ich nicht. Ich möchte keinen Gott, für den ich zuerst ein Abitur brauche. Ich glaube, das wesentliche im Glauben ist unaussprechlich. Es hat etwas, was tief ins Herz anrührt und zur Gewissheit führt: Gott ist da, ich bin behütet und von seiner Liebe umfangen. Und diese Erfahrung ist in der ostkirchlichen Liturgie besonders spürbar. Diese Demut gegenüber dem göttlichen Mysterium und auch insgesamt der apophatische Zugang der Theologie wirken auf mich so anziehend. Das kommt mir persönlich entgegen: Es muss nicht immer alles durchdekliniert, systematisiert und durchbuchstabiert sein, sondern es gibt eben auch diese heilige Scheu; Gottes Gegenwart und Gottesverbundenheit können nicht immer verbalisiert werden.
Haben Sie als Benediktinermönch auf dem Berg Zion auch die Möglichkeit, ostkirchliche Gottesdienste in der Heiligen Stadt zu besuchen und mitzufeiern? Was sind da Ihre Erfahrungen?
P. Nikodemus: Ich kann mich an verschiedene Gottesdienste sehr lebendig erinnern. Man macht ja verschiedene Erfahrungen, auch abschreckende. Auch solches habe ich bereits erlebt; es gibt auch ostkirchliche liturgische Feiern – es kommt immer auf den Liturgen an –, die einfach nachlässig gefeiert werden. In solchen Fällen dachte ich mir schon öfter: Muss das sein?
Was ich besonders schön erlebt habe, war die Nacht in der Grabeskirche. Man kann sich in dieser Kirche über Nacht einschließen lassen. Gerade in der Nacht, wenn alle Pilger und Touristen weg sind, kann die Schönheit und die Ruhe dieser heiligen Stätte bewundert und genossen werden. Erst dann wird dieser Ort durch die Liturgie wachgeküsst. Aufeinander folgt dann zuerst die Beweihräucherung durch die Diakone, erst der Grieche, dann der Armenier und schließlich der Kopte. Darauf folgt die griechische und die armenische Liturgie. Das sind geistlich gesehen wirklich intensive Momente. Erst da kann man sich als gläubiger Mensch in die Heilsgeschichte und in die Bedeutung dieser heiligen Orte versetzen. Ich empfehle den Pilgern sehr oft, diese Erfahrung zu machen.
Jerusalem ist eine heilige Stadt gleich für mehrere Religionen: Juden, Christen und Muslime. Es ist eine heilige Stätte die interreligiös gesehen nicht unbedingt spanungslos ist. Auch die einzelnen christlichen Konfessionen lebten leider nicht immer friedlich miteinander. Der Gründungsrektor des Collegium Orientale, Archim. Dr. Andreas Thiermeyer, war wie Sie im Studienjahr in Jerusalem. Er hatte damals die bittere Erfahrung gemacht, dass ostkirchliche Christen unterschiedlicher Konfessionen besonders an den Hochfesten und vor allem in der Auferstehungs- bzw. Grabeskirche miteinander streiten und dass es auch immer wieder zu richtigen Raufereien kommt. Dies war für ihn eine prägende Erfahrung und sie galt letztendlich als wichtiger Grund für die Gründung unseres Kollegs, in das Seminaristen, Diakone und Priester unterschiedlicher Riten und Konfessionen auf einem neutralen Territorium eingeladen sind, um miteinander zu leben, studieren sowie nicht zuletzt auch zu beten und um auf diese Weise einander kennen und schätzen zu lernen. Wie erleben Sie heute das Miteinander der Christen aus unterschiedlichen Konfessionen in Jerusalem und der Umgebung?
P. Nikodemus: Da habe ich wirklich gute Nachrichten. Oft gibt es ja diese Szenen und Beispiele von den sich prügelnden Mönchen in der Grabeskirche in Jerusalem oder in der Geburtskirche in Bethlehem. Hier werden dabei sehr genussvoll alte Kamellen aufgewärmt. In den letzten Jahren haben wir sowas nicht mehr gehabt. Man muss dazu sagen, dass dies eine positive Folge der leider zunehmenden antichristlichen Gewalt ist. Als Beispiele dafür stehen die Brände in Tabgha und Jerusalem, aber auch die Schmierereien. Dies ist eine ökumenische Angelegenheit: Das griechisch-orthodoxe Priesterseminar hat Anfang 2015 gebrannt, die Schmierereien betrafen die Armenier, die Griechen und uns Katholiken. Bösartig gesprochen, kann man sagen, die Gegner des Christentums sind ökumenischer als wir. Wir können gemeinsam angegriffen werden, weil wir getauft sind. Wir dürfen nur nicht gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen. Das heißt, wir sollten uns fragen, ob unsere Gegner nicht ökumenischer und visionärer denken als wir. Und tatsächlich, dadurch, dass wir immer weniger werden, und durch diese Erfahrung des gemeinsamen Angegriffenseins kann man feststellen, dass die interkonfessionellen Spannungen deutlich abgenommen haben. Denn wir nehmen einfach immer mehr wahr, wie peinlich und erbärmlich es ist, wenn wir uns streiten. Gott hat einen großen Humor und kann auf krummen Zeilen gerade schreiben: Durch das, was wir negativ erleben, kann auch etwas Gutes wachsen. Am visionärsten ist es im Gaza-Streifen: Dort haben wir drei Pfarreien, eine griechisch-orthodoxe, eine römisch-katholische und eine baptistische. Es gibt nichts Ökumenischeres als das Miteinander der Christen im Gaza-Streifen. Denn diese paar Christen, die es dort noch gibt, gehen alle am Samstagabend in die römisch-katholische Vorabendmesse, aber wirklich alle; sie gehen alle am Sonntagfrüh in die Göttliche Liturgie und gehen am Sonntagnachmittag zu den Baptisten zur Bibelstunde. Da haben wir nur eine Identität: Ein Christ ist ein Christ. Die Eltern fragen ihre Kinder nie: „Wen bringst Du da heim: einen römisch-katholischen oder einen griechisch-orthodoxen?“ Sie bringen ja einen Christen heim.
Viele Familien sind ein richtiges Patchworkuniversum an Konfessionen: der Schwager ist Maronit, die Tochter ist lutherisch und der Mann ist anglikanisch und die andere Tochter armenisch-katholisch. Durch diese Familiensituation kommen auch die für Christen so existentiellen Fragen nach dem gemeinsamen Ostertermin oder einem gemeinsamen Weihnachtstermin. Die Leute sagen, niemand draußen versteht doch mehr, warum wir Christen getrennt feiern. Das heißt, wir müssen doch mehr zusammenrücken. Was hier und auch in Syrien und im Irak, wo Christen Verfolgung erleiden, deutlich wird: die christlich-konfessionellen Streitereien sind wirklich einfach nur peinlich!
Der direkte christliche Nachbar der Dormitio-Abtei auf dem Zionberg ist doch das Armenisch-Apostolische, also das orthodoxe Patriarchat. Wie gestalten sich da die Beziehungen?
P. Nikodemus: Hervorragend. Sowohl zu den Armeniern als auch zu den Syrisch-Orthodoxen, die in diesem Viertel zuhause sind, sind die Beziehungen hervorragend. Wir haben fast immer armenische Mönche bei uns, die in die Vesper oder zum Gebet kommen. Das armenische Patriarchat in Jerusalem ist unter den Armeniern, die auf der ganzen Welt Neukalendarier sind, das einzige altkalendarische. Oft bereuen es die Jerusalemer Armenier, weil sie die Feste nicht gleichzeitig mit ihren armenischen Mitchristen feiern können. In praktischer Hinsicht erweist es sich aber als gut: Wenn jemand von den armenischen Klerikern und Bischöfen in Etschmiadzin in Armenien krank sein sollte, kann er die Feste in Jerusalem nachfeiern, also 13 Tage später. Die armenischen Gäste kommen immer zu uns zu Besuch; sie werden von ihren armenischen Mitbrüdern im Patriarchat zu uns gebracht. Wir haben auch einen Mitbruder Bernhard Maria, der im armenischen Priesterseminar unterrichtet. Da sind die Verhältnisse wirklich sehr gut. Auch unsere Mönche gehen immer wieder in die armenische Vesper. Es geht auch so weit, dass unser Altaltabt Nikolaus Egender die Auszeichnung eines Ehrenvartapeds der armenischen apostolischen Kirche verliehen bekam, also ein Ehrenkleriker oder Staurophorer Erzpriester wurde. Die Armenier sind ökumenisch sehr unkompliziert, sehr offen. Diese Offenheit gilt in erster Linie den Römisch-Katholiken. Wenn es um die Griechen geht, wird es schwieriger. Auch beim Papstbesuch war die große Frage, wer sitzt wo: Die Katholiken auf der einen Seite und die Orthodoxen auf der anderen; aber was ist mit den Orientalisch-Orthodoxen, besonders den Armeniern, sie sind ja auch eine Hauptkonfession der Christen? Die Armenier sagten, sie wollen bei den Katholiken sitzen. Unter den orientalisch-orthodoxen funktioniert die Ökumene also sehr gut.
Was die Beziehungen zum griechisch-orthodoxen Patriarchat von Jerusalem angeht, sind die Beziehungen nicht so einfach. Auch innerhalb der byzantinischen Orthodoxie wird das Jerusalemer Patriarchat durchaus sehr speziell wahrgenommen, was wohl auch daran liegt, dass dies die einzige Griechisch sprechende autokephale Kirche ist, die altkalendarisch ist, also ihre Feste nach dem julianischen Kalender feiert. Damit hat das Jerusalemer Patriarchat eine gewisse Anziehungskraft für gewisse – eher konservative –Leute. Aber auch hier kann man von einem ökumenischen Aufbruch im Kleinen sprechen. Ich habe einen griechisch-orthodoxen Freund aus Thessaloniki, mit dem ich das Thema vor nicht so langer Zeit besprochen habe und der sagte, sie wollten von ihrem antiökumenischen Image weg. Es gibt ja in Bethlehem eine griechische Mönchsgemeinschaft, die zugleich ein Bischofsitz ist. Sie haben dort vor kurzem eine Tagung zur Ökumene organisiert: es ging um das gemeinsame Zeugnis der Märtyrer; der dortige Bischof bemüht sich wirklich sehr in dieser Richtung. Das heißt, auch da ist etwas in Bewegung.
Im Zuge der großen Flüchtlingsströme nach Europa, besonders nach Deutschland, wird wohl auf unterschiedlichen Ebenen auch Interesse für die christlichen Flüchtlinge wachsen. Wenn wir uns die universitäre Landschaft anschauen, dann gibt es sehr wenige Lehrstühle und Institute für die Ostkirchenkunde und das ostkirchliche Christentum. Wie beurteilen Sie diese Situation?
P. Nikodemus: Da bin ich ordentlich skandalisiert. Das ist ein Thema, wo ich richtig emotional werden kann. Ich führe ja auch sehr viele Politiker im Heiligen Land und das ist ein Thema, ein Bereich, in dem ich Lobbyarbeit betreibe. Ich sage immer, es kann doch nicht sein, dass wir gerade in Deutschland enorm viele Steuergelder in die Hand nehmen, um so etwas wie islamische Theologie aufzubauen. Ich habe nichts dagegen und halte es auch für sinnvoll und richtig. Auf der anderen Seite muss in München die einzige Einrichtung für orthodoxe Theologie jedes Jahr ums Überleben kämpfen. Sie ist die einzige im ganzen deutschsprachigen Raum. Wenn man sich die theologischen Fakultäten anschaut, dann fällt mir nur Wien ein, wo es einen Lehrstuhl für Ostkirchenkunde gibt; hinzu kommt seit neuestem noch ein Lehrstuhl in Salzburg für syrische Theologie. Die neuesten Statistiken sagen, es gibt 1,7 Millionen Ostchristen in Deutschland, durch die Flüchtlinge, aber auch durch die EU-Erweiterung: Rumänien, Bulgarien, Griechenland und Zypern, die mehrheitlich orthodox geprägte Länder sind, deren Bürger nun in der EU volle Bewegungsfreiheit haben. Wenn man sich diese Zahlen vor Augen führt, dann muss man sagen, es kann doch nicht sein, dass es so wenig Kompetenz gibt in diesem Bereich, in dieser wichtigen Frage. In den Interviews, in denen ich als Ostkirchenexperte angefragt werde, sage ich oft: Es ist einfach erbärmlich, dass die Journalisten mich in Jerusalem anrufen müssen, weil wir in Deutschland nur sehr wenige Fachstellen haben, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Das ist wirklich erschreckend. Von der Geschichte her hatten wir gerade im deutschsprachigen Raum sehr berühmte Institutionen für den Bereich der Ostkirchenkunde. Das ist wirklich ein armseliges Zeugnis, wie wir da abgebaut haben und abbauen. Wir reden hier von Lehrstühlen, die nicht so viel kosten; wir reden nicht von wissenschaftlichen Projekten und Lehrstühlen für Atomphysik oder Medizin, die mit enormem finanziellem Aufwand verbunden sind. Wir reden von relativ leicht finanzierbaren Einrichtungen, die uns hier im Westen sprachfähig machen sollten – angesichts einer neuen Herausforderung. Es ist halt so, dass auf einmal Chaldäer, Syrer, Syrisch-Katholische, Maroniten usw. in das Land kommen und keiner von uns kann drei gerade Sätze zu diesen Leuten sagen. Und insgesamt die Situation: Man kann in Deutschland unbeschadet durch das gesamte Theologiestudium durchkommen, ohne jemals mit den Ostkirchen konfrontiert zu werden. Wenn man von der Ökumene hört, dann geht es meistens um die Fragen der Kirchen aus der Reformation. Bei aller Liebe muss man sagen: wir haben weltweit, wenn man wohlwollend schätzt, alle Bünde zusammen, 77 Millionen Lutheraner; und dies weltweit. Ja, allein die Russisch-Orthodoxe Kirche als autokephale Kirche hat mehr Gläubige als es Lutheraner gibt. Auch die orientalisch-orthodoxen Kirchen kommen zusammen locker drüber. Das sind alles schon Fragen, bei denen ich sagen muss: Das ist fast unverantwortbar. So deutlich sage ich es immer allen deutschen Politikern. Hier befleißige ich mich der Lobby-Arbeit und zwar wirklich und gerne, bis dahin, dass ich den Politikern dies für ihre Wahlkämpfe als Thema vorschlage und sage, wer kümmert denn sich um die, diese sind ja enormes Wählerpotenzial. Ich habe das einmal den FDP gesagt: Sie sind doch knapp über der 5%-Hürde, das wäre doch etwas, nehmen Sie sich doch dieser mal an. Wahrscheinlich lassen sich die orientalischen Christen gut integrieren. Damit ist auch die Frage des kulturellen Erhalts verbunden: Wie können sie ihre Identität und ihr Erbe, ihre Sprache bewahren. Das ist eine Frage und ein Thema, zu dem ich sehr ausführlich und auch pointiert Stellung nehmen kann und das tue ich auch. Da lasse ich keine Chance ungenutzt.
Wir befinden uns im Collegium Orientale, dem zweiten Priesterseminar des Bistums Eichstätt. Das Ziel ist, dass Studenten aus verschiedenen Ostkirchen hierher kommen, an der Theologischen Fakultät studieren und nach ihrem Abschluss in ihre Heimatkirchen zurückkehren. Derzeit haben wir 38 Kollegiaten aus neun Ländern und zwölf kirchlichen Jurisdiktionen. Was und wie kann das Collegium Orientale aus Ihrer Sicht als Lebens- und Studiengemeinschaft dazu beitragen, dass das christliche Miteinander in der Welt besser und deutlicher wird?
P. Nikodemus: Es kommen mir drei Punkte in den Sinn. Der erste, der bereits angesprochen wurde, ist, dass ihr der Gründungsidee treu bleibt, dass Ihr eine Lebens- und Lerngemeinschaft bildet und pflegt. Das ist übrigens auch das Rezept, das die Christen im Heiligen Land haben. Es gibt nichts Besseres, wenn man zusammen studiert, zusammen lernt, sei es in der Schule oder an der Universität. Dann kann ich nicht nur auf meine Vorteile bedacht sein. Es geht bei den anderen um meine Studienkollegen und Freunde. Wenn ich mich im Studium öffne, lerne ich, es gibt noch andere. Ähnliche Erfahrungen machen wir auch in unserer innerwestlichen Ökumene im Jerusalemer Studienjahr zwischen den katholischen und evangelischen Studenten. Dadurch entsteht eine Auflockerung und Bereitschaft, den anderen mit seinen Überzeugungen anzunehmen. Diese Grundidee des Collegium Orientale halte ich für sehr gut und kostbar. In einer solchen Lebensgemeinschaft schwinden die Vorurteile, weil durch den gemeinsamen Alltag Freundschaften entstehen, die dazu beitragen, dass der Nährboden für die Anhäufung von extremen Vorurteilen nicht mehr vorhanden ist. Das Zweite ist, vielleicht geschieht es auch bereits, die Strahlkraft nach außen. Wenn man sich im Herzen der Westkirche befindet, kann man deutlich machen, dass die Ökumene mehr ist als der evangelisch-katholische Dialog. Es soll vermittelt werden, dass in der Ökumene noch ein ganzer Kosmos an Gesprächspartnern besteht: in der Orthodoxie, der orientalischen Orthodoxie, den katholischen Ostkirchen usw. Dies könnte man auf unterschiedliche Weise organisieren, durch Gottesdienste in den Pfarreien des Bistums und darüber hinaus, durch bestimmte öffentliche Feste und Veranstaltungen wie z. B. einen Tag der Offenen Tür. So kann Informationsarbeit betrieben werden, denn das Unwissen über die Ostkirchen ist enorm. Drittens: Im Hinblick auf die einzige Katholische Universität im deutschsprachigen Raum hier in Eichstätt könnte ich mir vorstellen, dass hier ein Kompetenzzentrum in Sachen Ostkirche entstehen könnte. Soweit ich es sehen kann, geht es hier auch in die Richtung. Denn dies wäre wichtig für den christlichen Osten, gerade aktuell, in der Situation, in der wir das Gefühl haben, dass der Staat merkwürdig wegschaut. Ich glaube, da kann eine Katholische Universität visionärer vorgehen und sagen: Dann füllen wir diese Lücke aus, das erlauben wir uns finanziell, hier möchten wir die Kompetenz bündeln, die in Deutschland da war und die es nach wie vor noch gibt; wir versuchen gerade da sprachfähig zu werden und sein. Das machen wir zu unserem Profil, auch gegenüber der Öffentlichkeit als Kompetenzzentrum. Das wären so drei Punkte, die mir zu dieser Frage so spontan einfallen.
Vielen Dank, lieber P. Nikodemus! Über Ihren ersten Besuch in unserem Kolleg und das Kennenlernen haben wir uns sehr gefreut. Wir möchten mit Ihnen in Kontakt bleiben und wünschen Ihnen eine gesegnete Weiterreise. Sie sind uns auch in Zukunft ein willkommener Gast!